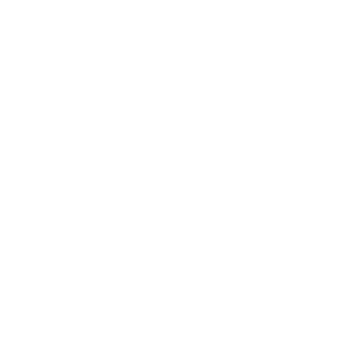Erfahre, warum Content Analyse in Marketing und Wissenschaft unterschiedlich funktioniert. Mit klarer Abgrenzung, Methodenvergleichen und praktischem Blick.
Neulich, bei einer Tasse Kaffee, habe ich einen Blick auf meine Content-Zahlen geworfen und musste plötzlich an mein Studium denken. An Hausarbeiten, Textauswertungen, Forschungsfragen und an das ganz andere Verständnis von „Analyse“, das ich damals gelernt habe.
Im Marketing spreche ich heute oft von Content Analyse:
- Was hat funktioniert?
- Wie viele haben geklickt?
- Wo kann ich optimieren?
Doch was wir da tun, hat mit wissenschaftlicher Analyse nur bedingt etwas zu tun. Und genau dieser Unterschied hat mich nicht mehr losgelassen.
Es lohnt sich, die beiden Perspektiven einmal nebeneinander zu stellen. Nicht, um zu sagen: Das eine ist besser als das andere. Sondern um zu verstehen, warum wir manchmal an Grenzen stoßen und wie wir durch mehr Klarheit bessere Entscheidungen treffen können.
In diesem Beitrag grenze ich deshalb Content Analyse im Marketing von wissenschaftlicher Analyse ab. Ich zeige dir, wo die Unterschiede liegen, wie sich die jeweiligen Methoden voneinander unterscheiden und wie du beide Ansätze gezielt nutzt, um deine Inhalte besser zu verstehen.
Zielsetzung: Was willst du eigentlich herausfinden?
Bevor du Zahlen sammelst oder Textstellen markierst, solltest du dir folgende Frage stellen: Worum geht es dir eigentlich? Möchtest du die Wirkung messen oder die Inhalte verstehen?
Im Marketing ist die Antwort meistens schnell gefunden: Du willst wissen, ob dein Content funktioniert. Daher misst du Klicks, Öffnungen, Likes und Reichweite. All das zielt auf eine konkrete Wirkung ab, ganz gleich, ob du mehr Sichtbarkeit, Vertrauen oder Anfragen erzielen möchtest. Deine Analyse hilft dir, genau das zu überprüfen.
In der Wissenschaft sieht das ganz anders aus: Dort geht es nicht in erster Linie um Performance, sondern um Erkenntnis. Du analysierst Inhalte, um etwas über die Welt herauszufinden, beispielsweise wie bestimmte Themen sprachlich behandelt werden oder welche Argumentationsmuster in Interviews vorkommen. Nicht das „Wie viele?“ steht im Vordergrund, sondern das „Was bedeutet das?“.

Beispiel gefällig?
Im Marketing fragst du: „Wie viele Leute haben auf den Link im Newsletter geklickt?”
In der Wissenschaft fragst du: „Welche Begriffe nutzen Menschen, wenn sie über Selbstständigkeit sprechen?”
Beides hat seine Berechtigung, aber es erfordert vollkommen unterschiedliche Herangehensweisen. Und eben auch andere Methoden. Diese schauen wir uns jetzt an.
Methodik: Wie du analysierst, hängt von deinem Ziel ab.
Wenn dein Ziel klar ist, kannst du mit der Umsetzung beginnen. Hier zeigt sich der Unterschied zwischen Marketing-Analyse und wissenschaftlicher Analyse besonders deutlich.
Im Marketing arbeitest du so:
Du greifst zu Tools wie Google Analytics, Matomo, LinkedIn Insights oder deinem Newsletter-Dashboard (z.B. Kit). Sie zeigen dir Zahlen, Trends und Diagramme.
Du siehst:
- Wie viele Menschen haben deinen Beitrag gesehen?
- Wie lange waren sie auf deiner Website?
- Welcher Button wurde am häufigsten geklickt?
Solche Tools arbeiten automatisiert. Du musst nur interpretieren, nicht viel eingeben. Und das möglichst im Verhältnis zu deinen Zielen. Es geht um Überblick, Vergleich und Handlungsempfehlungen. Was lief gut und was kannst du besser machen?
Und so arbeitet die Wissenschaft
In der Wissenschaft sieht das anders aus: Hier arbeitest du oft manuell – aber mit einem klaren Methodengerüst. Wenn du beispielsweise eine qualitative Inhaltsanalyse durchführst, benötigst du:
- ein Kategoriensystem (was genau suchst du im Text?),
- Kodierregeln (wie entscheidest du, ob etwas in eine Kategorie passt?),
- ggf. mehrere Personen, die unabhängig voneinander codieren (Stichwort: Inter-Rater-Reliabilität).
Du liest Texte, markierst Aussagen, ordnest sie zu, vergleichst und interpretierst sie. Das dauert. Und es braucht ein sauberes Konzept. Aber es hilft dir, sprachliche Strukturen, Deutungsmuster oder gesellschaftliche Trends sichtbar zu machen – ganz ohne Klickrate.
Was bedeutet das für dich?
Wenn du im Marketing tätig bist, kannst du viel aus der wissenschaftlichen Methodik lernen, vor allem, wenn du nicht nur wissen willst, was funktioniert, sondern auch warum. Und umgekehrt: Wenn du mit wissenschaftlichem Anspruch arbeitest, beispielsweise in einer Studie oder Veröffentlichung, reicht ein Analytics-Tool allein nicht aus.
Im nächsten Schritt betrachten wir die unterschiedlichen Datenquellen, mit denen beide Bereiche arbeiten, und warum das für deine Analyse eine wichtige Rolle spielt.
Datenquellen: Welche Inhalte du analysierst, ist entscheidend
Wenn du analysieren möchtest, brauchst du zunächst Daten. Welche Art von Daten du nutzt, hängt jedoch direkt mit deiner Zielsetzung und Methodik zusammen.
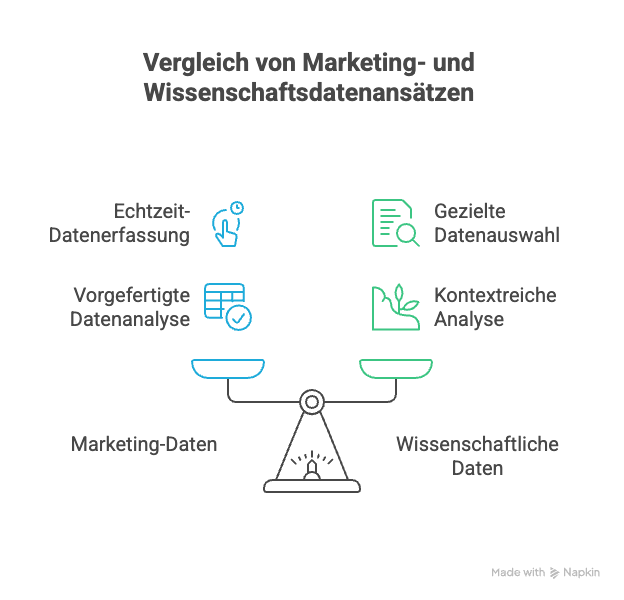
Im Marketing greifst du auf Live-Daten zu.
Du nutzt Tools, die dir in Echtzeit zeigen, was passiert:
- Matomo oder Google Analytics liefern dir beispielsweise Zahlen zu Seitenaufrufen, Verweildauer und Absprungrate.
- Social-Media-Insights geben dir Daten zu Likes, Shares und Reichweite.
- Kit oder andere Newsletter-Tools zeigen dir die Öffnungs- und Klickraten.
Diese Daten sind in der Regel bereits aufbereitet. Du musst nur noch entscheiden, welche Daten du dir anschaust. Das spart Zeit und hilft dir, Trends zu erkennen. Aber: Du bekommst damit nur das, was das Tool misst. Und das ist oft rein quantitativ.
In der Wissenschaft sammelst du Informationen gezielt und bewusst.
Anstelle automatisch erfasster Zahlen arbeitest du hier mit ausgewählten Texten, Audiodateien, Transkripten oder Screenshots. Du brauchst:
- eine klare Auswahlstrategie (z.B. „Ich analysiere zehn Interviews mit Selbstständigen“).
- einen definierten Ausschnitt (z.B. Kommentare zu einem bestimmten Thema oder Zeitraum).
- eine saubere Aufbereitung (z.B. Transkripte, gegliederte Textsammlungen).
Das ist zwar aufwendiger, gibt dir aber deutlich mehr Kontext. Du kannst nachvollziehen, was Menschen genau sagen, wie sie argumentieren und welche Begriffe sie benutzen. All das kannst du anschließend systematisch auswerten.
Was du mitnehmen kannst:
Wenn du tiefer verstehen willst, warum bestimmte Inhalte gut funktionieren, kannst du von der Wissenschaft lernen.
Nimm dir beispielsweise regelmäßig eine Handvoll Kommentare oder E-Mails vor und analysiere sie qualitativ. So erhältst du nicht nur Zahlen, sondern auch Sprache, Haltung und Motive.
Damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt: der Auswertung dessen, was du gesammelt hast.
Auswertung: Hypothesen testen oder Muster entdecken?
Du hast jetzt Daten. Egal, ob sie aus deinem Dashboard oder einem Word-Dokument stammen. Jetzt entscheidest du: Wie gehst du an die Auswertung heran?
Im Marketing willst du Hypothesen bestätigen oder verbessern.
Du arbeitest meistens hypothesengeleitet. Du möchtest prüfen, ob etwas funktioniert hat:
- Hat das neue Posting-Format mehr Reichweite gebracht?
- Hat die kurze Betreffzeile zu mehr Öffnungen geführt?
- Lohnt sich die Landingpage überhaupt?
Das bedeutet, dass du Zahlen vergleichst, Varianten testest (A/B-Tests) und deine Strategie anpasst. Du willst schnell sehen: Ja oder nein? Beibehalten oder optimieren?
In der Wissenschaft gehst du offen heran.
Hier lässt du die Daten erst einmal für sich sprechen. Du suchst nicht die Bestätigung für etwas, das du bereits denkst, sondern schaust:
- Welche Themen tauchen auf?
- Welche Begriffe werden wie verwendet?
- Welche Muster erkenne ich in den Aussagen?
Du arbeitest oft explorativ. Dabei entdeckst du Strukturen, an die du vorher vielleicht nicht gedacht hast. Und genau das macht diese Art der Analyse so wertvoll, denn sie hilft dir, neue Perspektiven zu entwickeln.
Und was bringt dir das für deinen Content-Alltag?
Wenn du in deinem Marketing öfter das Gefühl hast, auf der Stelle zu treten – immer die gleichen Formate, Zahlen, Erkenntnisse hast –, lohnt sich ein Perspektivenwechsel. Mach einmal im Monat eine qualitative Mini-Auswertung. Lies Kommentare, markiere Formulierungen und frage dich: Was taucht immer wieder auf?
Das hilft dir, Muster zu erkennen, statt nur Zahlen zu zählen.
Im nächsten Abschnitt zeige ich dir, wie unterschiedlich die Präsentation von Analyseergebnissen ausfällt, je nachdem, aus welchem Bereich du kommst.
Ergebnispräsentation: Zeigst du nur die Zahlen oder erzählst du auch, was dahinter steckt?
Wenn du analysierst, möchtest du am Ende nicht nur verstehen, was passiert ist, sondern es auch weitergeben. An dein Team, deine Community oder einfach an dich selbst bei der nächsten Content-Planung.
Die Frage ist also: Wie präsentierst du deine Ergebnisse? Und genau hier unterscheidet sich die Praxis im Marketing deutlich vom wissenschaftlichen Arbeiten.
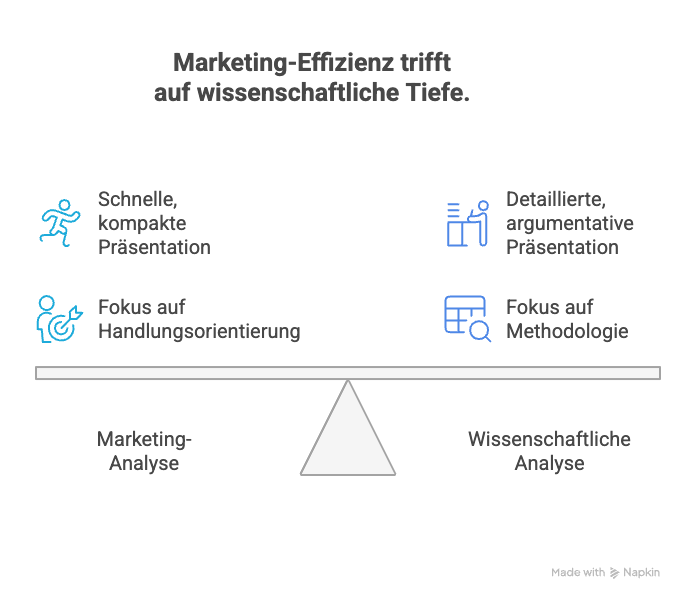
Im Marketing gilt: schnell, kompakt, auf den Punkt.
Deine Auswertungen sollten verständlich, effizient und handlungsorientiert sein. Du nutzt Dashboards, ziehst Screenshots aus Matomo oder LinkedIn und erstellst eine kurze Präsentation mit den wichtigsten Zahlen.
Öffnungsraten, Reichweitenvergleiche, Klicktrends: Alles ist so aufbereitet, dass es auf einen Blick erfasst werden kann. Oft geht es dabei nicht nur um das „Was“, sondern vor allem um das „Was jetzt?“. Was leitest du daraus für den nächsten Monat ab? Welche Formate wiederholst du? Wo justierst du nach?
Das funktioniert gut, solange du dich nicht nur auf die Zahlen selbst verlässt. Denn Zahlen ohne Kontext können leicht fehlinterpretiert werden. Ein Beitrag mit weniger Reichweite ist nicht automatisch schlechter. Vielleicht war er persönlicher, emotionaler und näher an deiner Community. Das zeigen dir Zahlen allein nicht.
In der Wissenschaft ist der Weg genauso wichtig wie das Ergebnis.
Wenn du wissenschaftlich arbeitest, dann zählt nicht nur das Ergebnis, sondern vor allem die Art und Weise, wie du zu diesem Ergebnis gelangt bist. Deine Analyseergebnisse sind in eine Argumentation eingebettet. Du beschreibst, was du analysiert hast, mit welcher Methode du gearbeitet hast und welche Kategorien du gebildet hast – und warum.
Das Ergebnis ist in der Regel ein zusammenhängender Text. Du ordnest Zitate ein, benennst Muster und reflektierst über Unsicherheiten. Und: Du musst deine Schlüsse nachvollziehbar machen. Das bedeutet auch, Widersprüche zu benennen und zu begründen, warum du dich für eine bestimmte Deutung entschieden hast.
Was das konkret für dich heißt: Wenn du Content-Feedback oder qualitative Auswertungen machst, beispielsweise von Kommentaren, Interviews oder Community-Fragen, kann es sich lohnen, mehr als nur die Ergebnisse zu zeigen. Erzähle auch den Weg dorthin. Schreibe auf, wie du zu deinem Fazit gekommen bist. So kannst du auch besser prüfen, ob deine Bewertung wirklich tragfähig ist oder eher aus dem Bauchgefühl kam.
Nimm dir das Beste aus beiden Welten!
Du musst dich nicht zwischen Dashboards und Fußnoten entscheiden. Frag dich aber: Brauche ich für diese Auswertung Klarheit oder Tiefe – oder beides? Oft hilft eine Kombination.
Zeige beispielsweise deine Zahlen und ergänze sie durch zwei oder drei echte Aussagen deiner Community. Oder beschreibe kurz, warum du bestimmte Ergebnisse nicht überbewertest. Das macht deine Auswertung robuster. Und sie ist für andere besser nachvollziehbar.
Doch nun zur Kernfrage hinter jeder Analyse: Wie sicher kannst du dir mit deinen Ergebnissen eigentlich sein?
Validität und Reliabilität: Wie belastbar sind deine Ergebnisse?
Zahlen wirken oft objektiv. Eine Öffnungsrate von 45 % sieht beispielsweise aus wie ein Fakt. Ein Besucherpeak in Matomo scheint ein klarer Erfolg zu sein.
Aber wenn du genauer hinschaust, merkst du schnell: Solche Ergebnisse sind immer nur so belastbar wie die Methode, mit der sie erzielt wurden. Und genau hier kommen zwei Begriffe aus der Wissenschaft ins Spiel, die auch für dein Marketing Gold wert sind: Validität und Reliabilität.
Validität: Misst du tatsächlich das, was du wissen möchtest?
Die Validität fragt: Passt das Messinstrument zu deiner eigentlichen Frage?
Wenn du beispielsweise herausfinden möchtest, ob dein Newsletter Vertrauen aufbaut, sagt dir die Klickrate auf ein Produkt möglicherweise nur bedingt etwas. Oder wenn du wissen willst, ob dein Blogartikel wirklich gelesen wurde, reicht es nicht, nur die Seitenaufrufe zu betrachten. Vielleicht kamen viele über Google, sind aber nach drei Sekunden wieder weg.
Deshalb lohnt es sich, bei jeder Analyse einmal innezuhalten und zu fragen: „Welche Aussage möchte ich treffen – und welche Zahl unterstützt das wirklich?”
Eventuell musst du deine KPIs anpassen. Eventuell benötigst du auch eine zusätzliche qualitative Beobachtung, z.B. eine Rückmeldung per E-Mail oder einen Kommentar, der zeigt, wie der Inhalt wahrgenommen wurde.
Reliabilität: Würdest du oder jemand anderes zu ähnlichen Ergebnissen kommen?
Reliabilität meint: Wie stabil ist deine Analyse? Wenn du morgen noch einmal auf dieselben Zahlen oder Texte schaust, kommst du dann wieder zum gleichen Schluss? Oder hast du gestern einfach „nach Gefühl“ bewertet?
In der Wissenschaft löst man dieses Problem durch systematische Verfahren: Zwei Personen analysieren unabhängig voneinander und gleichen danach ihre Ergebnisse ab. Du musst das nicht eins zu eins übernehmen, aber die Idee dahinter ist nützlich.
Für deinen Arbeitsalltag bedeutet das: Hol dir regelmäßig eine zweite Meinung ein. Zeige deinem Team eine Auswertung und frage:
- Würdet ihr das genauso deuten?
- Oder: Was seht ihr, wenn ihr euch diesen Kommentar anschaut?
Auch eine wiederholte Selbstanalyse ein paar Tage später kann dabei helfen, blinde Flecken zu erkennen.
Mach es dir zur Gewohnheit, deine Schlüsse zu hinterfragen!
Du musst nicht alles wissenschaftlich absichern. Aber du kannst dir immer eine einfache Frage stellen: Wie sicher bin ich mir eigentlich – und warum? Je klarer du diese Frage beantworten kannst, desto fundierter wird deine Content-Strategie. Und desto besser kannst du argumentieren, warum du etwas tust – oder eben nicht.
Im nächsten Schritt schauen wir uns an, was du mit allen diesen Ergebnissen machst: Reagierst du direkt oder baust du langfristig um?
Handlung: Optimierst du oder entwickelst du die Ergebnisse weiter?
Du hast analysiert, eingeordnet und hinterfragt. Die Frage ist: Was machst du mit den Ergebnissen? Hier zeigt sich vielleicht der deutlichste Unterschied zwischen Marketing-Logik und wissenschaftlicher Arbeit: Im Marketing geht es oft um schnelle Optimierung. In der Wissenschaft geht es eher um langfristige Erkenntnisse.
Im Marketing möchtest du am liebsten sofort etwas verändern.
Du siehst eine Zahl und reagierst. Die Klickrate ist eingebrochen? Du passt die Betreffzeile an. Ein Reel performt überdurchschnittlich gut? Du planst direkt ein ähnliches ein. Das ist sinnvoll, weil du damit nah an deinem Ziel arbeitest, zum Beispiel mehr Anfragen, höhere Sichtbarkeit oder eine stärkere Bindung zu erreichen. Du setzt auf kleine Stellschrauben, die du laufend justierst.
Diese direkte Umsetzung ist eine große Stärke. Aber sie birgt auch die Gefahr, dass du nur kurzfristig reagierst und langfristige Muster übersiehst. Wenn du dir nur den letzten Beitrag anschaust, entwickelst du kein Gespür für übergeordnete Themen oder Tendenzen.
In der Wissenschaft baust du Wissen systematisch auf.
Wenn du wissenschaftlich analysierst, verfolgst du keinen unmittelbaren Optimierungszweck. Zunächst willst du verstehen, um dann auf Basis dieser Erkenntnis etwas zu entwickeln. Eine Theorie, ein Konzept, ein neues Verständnis. Du änderst nicht sofort die Methode, nur weil ein Text aus dem Rahmen fällt.
Stattdessen fragst du: Was sagt mir dieser Ausreißer über mein Thema?
Diese Haltung kann dir auch im Marketing helfen, insbesondere in Phasen, in denen du grundsätzliche Dinge hinterfragst. Zum Beispiel:
- Ist mein Newsletter eigentlich noch das richtige Format für meine Community?
- Stimmen die Themen, mit denen ich mich zeige, noch mit meiner Positionierung überein?
- Oder: Welche Sprache verwendet meine Zielgruppe – und wie weit bin ich davon entfernt?
Kombiniere schnelle Reaktion und strategisches Lernen.
Du musst dich nicht entscheiden. Du kannst Ergebnisse direkt in deine Content-Planung einfließen lassen und gleichzeitig regelmäßig innehalten, um übergeordnete Schlüsse zu ziehen.
Plane bewusst kleine Analyse-Blöcke ein, in denen du nicht auf kurzfristige Zahlen, sondern auf langfristige Fragen schaust. So entwickelst du nicht nur deinen Content, sondern auch deine Haltung, deine Themen und dein gesamtes Marketingverständnis weiter.
Und damit sind wir beim Schlussgedanken.
Fazit: Nicht jede Content Analyse ist gleich und genau das bringt dich weiter.
Als ich bei einer Tasse Kaffee an meine Studienzeit zurückdachte, war das ein nostalgischer Moment. Doch je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir: Im Marketing und in der Wissenschaft reden wir zwar beide von „Content Analyse”, meinen aber völlig unterschiedliche Dinge.
Und das ist gut so. Denn du kannst aus beiden Welten etwas mitnehmen:
- Aus dem Marketing sind es schnelle Entscheidungen, konkrete Optimierungen und klare KPIs.
- Aus der Wissenschaft: systematisches Denken, bewusste Fragestellungen und strukturiertes Auswerten.
Wenn du beides verbindest, entsteht eine neue Tiefe. Du verlässt dich nicht mehr nur auf Dashboards, sondern entwickelst ein echtes Verständnis dafür, was deine Inhalte leisten. Du merkst, wann eine hohe Zahl nichts bedeutet und wann ein einzelner Kommentar alles verändert.
Für mich ist das der eigentliche Mehrwert von Content Analyse: Nicht nur das zu sehen, was messbar ist, sondern auch das, was wirklich wirkt – bei dir und bei den Menschen, die deine Inhalte lesen, hören oder anschauen.
Wenn du also das nächste Mal analysierst, frage dich nicht nur: „Was lief gut?”
Frag auch: Was erzählt mir dieser Inhalt?
Denn genau da beginnt die eigentliche Arbeit und echtes Lernen.